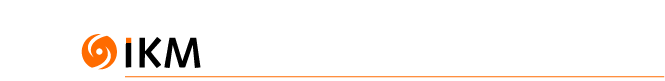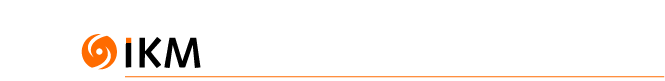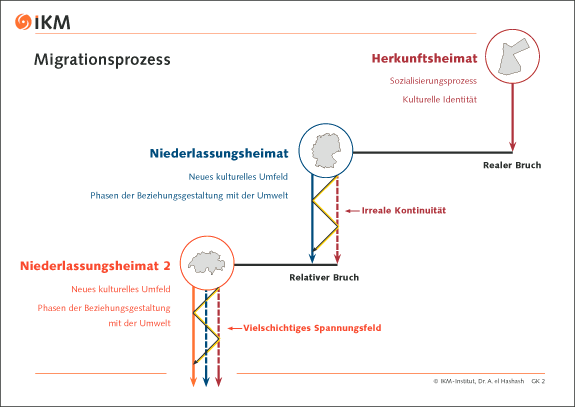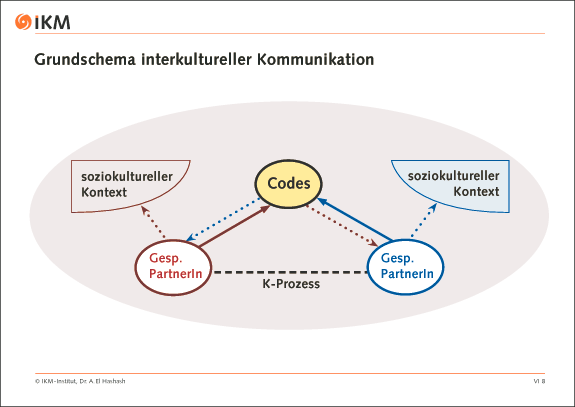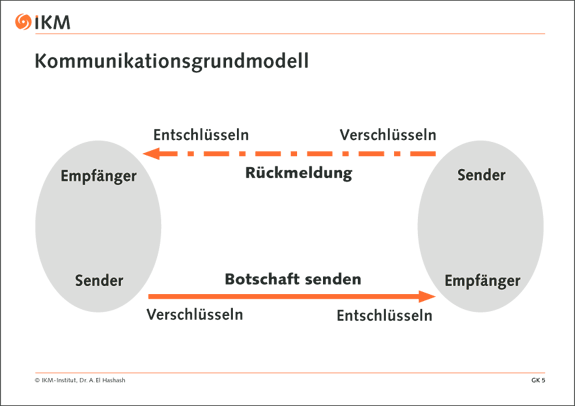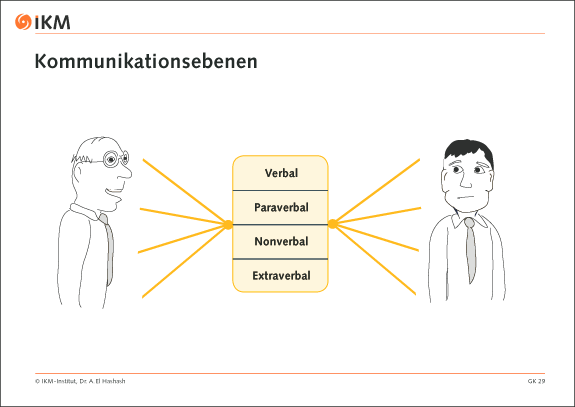Vortrag: Interkulturelle Kommunikation – Ursachen von Missverständnissen, Problemfelder und Lösungsansätze*
Dr. Ali El Hashash
Herr Moos, herzlichen Dank für die sehr netten einleitenden Sätze und die Einladung an diesem Sprachentag mitwirken zu dürfen.
Meine verehrten Damen und Herren!
Ich freue mich sehr in der mir noch verbleibenden Zeit mit Ihnen über das Thema «Interkulturelle Kommunikation» möglichst interaktiv und praxisbezogen zu diskutieren. Zu Beginn möchte ich vorausschicken, dass ich vor einer doppelten Herausforderung stehe: Zunächst wird es für mich schwierig sein, nach der erstklassigen künstlerischen Darbietung von Herrn Rocchi Ihre Aufmerksamkeit auch nur ansatzweise aufrechtzuerhalten. Zum zweiten ist mir bewusst, dass ich Aspekte einer höchst komplexen Thematik für Sie als FachkollegInnen, Sprach- und KommunikationsspezialistInnen in sehr kurzer Zeit zu behandeln habe. Die Interaktion mit Ihnen ist gerade deswegen von zentraler Bedeutung, weil wir das Thema aus verschiedenen fachlichen und kulturellen Blickwinkeln entsprechend beleuchten wollen.
Diese Begegnung mit Ihnen ist hochgradig interkulturell. Sie stellt gleichsam die Verkörperung interkultureller Kommunikation par excellence dar. Auf der einen Seite stehen Sie, in Ihrer fachlichen und kulturellen Vielfältigkeit, auf der andern ich, mit meinem undefinierbaren kommunikativ-kulturellen Identitäts-Mix. Aus diesem Grund habe ich keinen schriftlich fixierten Text vorbereitet, sondern einige Graphiken mitgebracht, die wesentliche Aspekte interkultureller Kommunikation ganz aus meiner kulturell gefärbten Sicht der Dinge illustrieren sollen. Ich vertraue voll und ganz auf den Interaktionsprozess mit Ihnen. Was aus dieser Begegnung entstehen wird, ist nicht vorhersehbar und entspricht folglich ganz dem Geist interkultureller Kommunikation als Interaktionsprozess. Die Art, wie ich Ihnen Inhalte überbringe und die Art wie Sie Ihre Kommentare, Bemerkungen und Diskussionsbeiträge abgeben oder Begriffe benutzen, erlauben uns keine Vorhersage darüber zu machen, ob wir am Ende zu einer «akzeptablen» Verständigung innerhalb unserer Thematik kommen werden. Genau dies macht interkulturelle Kommunikation so spannend. Das Ergebnis einer interkulturellen Überschneidungssituation wie diejenige, in der wir uns gerade befinden, stellt immer etwas Neues dar, das auf Grund unserer unterschiedlichen Kulturen und Erwartungen nicht mit dem identisch sein kann, was vor unserer Begegnung vorhanden war. Interkulturelle Kommunikation ist ein Prozess, der sich in keiner Weise mit zementierten Klischees (oder: eingefahrenen Vorstellungen) verträgt. Ich bediene mich momentan in meinen Ausführungen einer Fremdsprache, nämlich dem Deutschen. Die Worte, die Sie aufnehmen, kommen Ihnen sprachlich sicherlich bekannt vor. Nur: Meinen wir dasselbe? Welche Assoziationen lösen die Worte bei Ihnen aus? Auf welche soziokulturellen Konzepte stosse ich bei Ihnen mit meinen Begriffen? Sind diese Begriffe bei mir im Unterschied zu Ihnen eventuell mit ganz anderen, vielleicht gar konträren Bedeutungsinhalten assoziiert? Ich bitte Sie deshalb, mich jederzeit zu unterbrechen, damit ich das Gesagte kommentieren kann.
Eine Frage möchte ich gleich zu Beginn an Sie richten:
Können wir – Sie als DolmetscherIn, ÜbersetzerIn, KommunikationsspezialistIn und überhaupt wir alle – hinsichtlich der Art wie wir die Welt betrachten und wahrnehmen, neutral und objektiv sein? (...)
Ich halte fest: Die Art und die Inhalte unserer Wahrnehmung, unserer Interpretationen und Bewertungen, folglich unseres gesamten Verhaltens oder anders gesagt unserer Kommunikation, sind vollumfänglich vom kulturellen Umfeld abhängig und zwar im Rahmen dessen, wie wir sozialisiert worden sind. Diese Sozialisierung bildet die Brille, durch die wir die Welt und die Ereignisse um uns herum sehen und die es ermöglicht uns darin zu orientieren. Da Menschen auf dem Globus in gänzlich unterschiedlichen Umwelten leben, unterscheidet sich jeweils auch die Beschaffenheit ihrer Brillen. In diesem Sinne können wir als Gattung Mensch weder neutral noch objektiv sein. Besonders den Journalisten und Journalistinnen unter uns wird diese Feststellung wenig Freude bereiten. Sie führt zu einer weiteren Frage, nämlich derjenigen, ob sich Menschen im interkulturellen Kontext – natürlich bevor sie ein Seminar bei uns besucht haben – je verstanden haben bzw. verstehen werden. (...)
Vermutlich nicht. Ich wage sogar zu behaupten, dass Menschen in interkulturellen Begegnungen nur unter der Annahme der Existenz universalistischer und allgemein gültiger Bedeutungsinhalte von Begrifflichkeiten leben. Die Kontexte bzw. die kulturell-historisch gewachsene Deutungstiefe bleiben uns Fremdkulturellen hingegen verborgen. Wir erliegen in Wirklichkeit einer fundamentalen Täuschung darüber, dass wir uns gegenseitig verstehen. Dies ganz dem menschlichen Wahrnehmungssystem entsprechend, wonach wir offenbar ganz wenige Informationen brauchen, um uns individuell ein vollkommenes Konstrukt der Wirklichkeit zu schaffen. Und dieses Konstrukt stellt gleichsam die letzte für uns gültige Instanz der Wahrheit schlechthin dar. Und zwar jederzeit und für alle gültig!
Ich weiss nicht, ob die Menschheit wegen oder gerade trotz dieser Annahme überlebt hat. Ich wage nicht zu erahnen, was geschehen würde, wenn wir Menschen im interkulturellen Kontext tatsächlich wüssten, was wir voneinander denken und halten. Immerhin können wir uns mit Leichtigkeit hinter den von uns produzierten Missverständnissen oder Ausrutschern verbergen. Bestenfalls durch Entschuldigungen von angeblich Entschuldbarem oder durch Beschwichtigungen der Art «Ich habe es doch gar nicht so gemeint.»
In dieser Hinsicht können uns die gegenwärtigen international geführten Debatten über heiße oder kalte Kriege zwischen den Kulturen bzw. der Kampf über den Kampf der Kulturen aufschlussreiche Informationen liefern. Zu erwähnen wäre in diesem Zusammenhang die Propaganda der amerikanischen Denkfabriken zur Legitimierung der Invasion in den Irak. Diese ideologisch motivierten und kognitiv bewussten Desinformationen zur Durchsetzung materieller Interessen stellen aber nicht den Ausgangspunkt meiner Ausführungen dar. Vielmehr sind es die unbeabsichtigten Missverständnisse und Konfusionen innerhalb der interkulturellen Kommunikation. Diese Missverständnisse können durch Bewusstmachung und Bewusstwerdung vermieden werden.
Folgende Eckpunkte sind Gegenstand der nachstehenden Ausführungen und bilden damit den Rahmen unserer Diskussion:
– Bestandesaufnahme: Die Beschreibung einer interkulturellen Situation
– Das Schlüsselproblem: Ursachen von Missverständnissen und weitere Problemfelder
– Lösungen und Lösungsansätze
Bevor wir die Wasseroberfläche der interkulturellen Begegnung verlassen, in die Tiefe des Ozeans kultureller Vielfalt tauchen und uns auf Entdeckungsreise der kulturell-kommunikativen Unterschiede machen, scheint es mir angebracht zu sein, einen Blick auf die folgende Grafik zu werfen. Es handelt sich um meine persönliche Migrationsreise. Sie soll retrospektiv die Bedeutung der jeweiligen eigenen Reise reflektieren. Diese bildet immer den Hintergrund einer interkulturellen Begegnung. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens eine Gesprächspartnerin/ein Gesprächspartner jeweilen eine kürzere oder längere Reise angetreten haben muss und sich auf kulturell fremdem Terrain bewegt. Retrospektiv sage ich deshalb, weil mir seinerzeit die Bedeutung nicht bewusst war.
|
|
|
Folie 1 (Migrationsreise)
Geboren bin ich in Jordanien. Dort durchlief ich bis zum 18. Lebensjahr meine erste Sozialisierungsphase. In diesem Lebensabschnitt und in der Interaktion mit dem dortigen sozialen Umfeld, erfuhr meine Persönlichkeitsentwicklung ihre erste und sehr wichtige Formierungsphase. Ich kann mich u.a. sehr gut erinnern an die Erzählungen meiner Großmutter, an die Menschen um mich herum, an Geschichten und Mythen darüber, wer wir sind und wer wir waren. Ich habe durch die Vorbilder unbewusst alle Regeln der Kommunikation gelernt. Dabei wurde nicht nur mein Selbstbild geformt, sondern ich wurde auch – und dies viel nachhaltiger – dahingehend geprägt, wie ich die Welt sehe, mich darin orientiere und mich darüber in der zwischenmenschlichen Beziehung kommunikativ mitteile.
Die Kontinuität dieses Prozesses erlitt zu dem Zeitpunkt einen realen Bruch, als ich mit ca. 18. Jahren nach Deutschland ging um dort zu studieren. Mit der Ankunft in Frankfurt am Main, wurde eine neue Phase der Identitätsbildung eingeläutet, deren Verlauf fortan durch ein Spannungsfeld charakterisiert war, dessen Pole zwei sich gegenüberstehende und miteinander in Interaktion tretende Welten mit all ihren Facetten bis hin zu den kleinsten Elementarteilen darstellten: Eine erlebbare aber nicht begreifbare Realität des neuen kulturellen Umfeldes und mein bisheriges begreifbares, nun aber zur Irrealität verbanntes Fata-Morgana-Identitäts-Konstrukt. Selbst das nach meiner Empfindung graue, neblige, kalte und bedrückende Wetter erlebte ich als Schock. Nebenbei gesagt: Oft unterschätzen wir die Wirkung ungewohnter klimatischer Bedingungen, die neben der fremden sozialen Umwelt zusätzlich auf uns einwirkt.
Während ich die erste Phase, ohne Kenntnisse in der deutschen Sprache, als sehr interessant erlebte (Ich meine mit der ersten Phase v.a. das Nachtleben...), stellte ich fest, dass all meine gewohnten Klärungsmuster, die bis anhin als Orientierungssystem in der Interaktion mit meinem sozialen Umfeld gedient hatten, versagten. Rückblickend kann ich sagen, dass ich mich in einem Spannungsfeld befand, das zwischen ständigen Versuchen des Sich-Verständlich-Machens und -Verstehens und Missverständnissen im privaten und universitären Alltag hin und her pendelte.
Je besser ich mich in der deutschen Sprache auszudrücken vermochte, desto öfter traten Missverständnisse auf und desto grösser waren auch deren Auswirkungen. Dieser Umstand wiederholt sich bei interkulturellen Begegnungen überall und immer wieder und hat mit den Erwartungen der Gesprächspartner – in meinem Fall der deutschen Gesprächspartner – zu tun: Durch meine sprachliche Kompetenz wurden mir automatisch und unbewusst Kenntnisse von kulturspezifischen, soziokulturellen Kontexten zugeschrieben, was der Realität aber nicht entsprach. Ich sprach zwar deutsch, wandte aber meine eigenen soziokulturellen Bedeutungsinhalte als Erklärungsmuster an. Weder mir noch meinen Gesprächspartnern – und ich bewegte mich im akademischen Umfeld – war bewusst, dass wir uns auf unterschiedliche und sehr weit auseinander klaffende soziokulturelle Konzepte in der Kommunikation bezogen.
Die Deformation meiner bisherigen Identität und das Basteln an einer neuen, migrationsbedingten Daseinsform wurden zusätzlich massiv beeinflusst durch erlebte Ausgrenzungen und meine immer stärker wahrgenommene Andersartigkeit. Dieses akrobatische, unbewusst erfolgende Herumbasteln an meiner neuen Identitätsform war weder einfach noch der interkulturellen Interaktion in meinem Umfeld förderlich. Allein banale Fragen wie: «Woher kommen Sie?» oder «Was machen Sie?» lösten Verunsicherung aus. Spätestens mit der Anschlussfrage «Wann kehren Sie zurück?» wurde die Kommunikation mit meinen deutschen Gesprächspartnern beendet, meistens mit einer happigen Antwort meinerseits, wie: «Was geht Sie verdammtes ... das an?»
Dass die an mich gerichteten Fragen Bestandteil eines versuchten Smalltalks sein könnten, habe ich, trotz meines Studiums, erst viele Jahre später erfahren. Die Frage, wie viel Energie dafür vergeudet wurde, erübrigt sich.
Mir persönlich war – wie wahrscheinlich vielen anderen Migranten/Migrantinnen – nicht bewusst, dass ich einen zweiten, unsichtbaren Koffer mitschleppte, dessen Existenz ich nicht wahrnahm. Gleichwohl bediente ich mich in der Interaktion mit dem neuen kulturellen Umfeld unbewusst dessen Inhalt, den ich als Orientierungssystem benutzte. Salopp gesagt: Ich versuchte, die mir unbekannten Phänomene mit Hilfe untauglicher Instrumente zu klären. Durch meine Tätigkeit als Berater von Migranten und Migrantinnen gelangte ich erst ein Jahrzehnt später zur wissenschaftlichen Aufarbeitung dieser Problematik. Ich ging auf Entdeckungsreise und erkannte zunächst die Vielschichtigkeit meiner eigenen kommunikativen Handlungen und danach diejenige meiner Klientel mit ihren sehr viel tiefer liegenden soziokulturellen Konzepten.
Nachdem ich zunächst nach Basel übersiedelt hatte, dachte ich, dass die Unterschiede zu Deutschland nicht allzu gross sein würden. Spätestens in der Interaktion mit Deutschschweizern aus meinem Bekanntenkreis stellte ich aber fest, dass diese vermeintlich minimalen Unterschiede zu ähnlich grossen Missverständnissen wie in Deutschland führten.
Ein Beispiel: Die Art und Weise wie wir kontroverse Gespräche über eine Thematik organisierten, klaffte sehr stark auseinander. Während ich im Gespräch meist den Dissens im Fokus hatte, betonten meine Gesprächspartner zunächst die Konsensaspekte. Auch die unterschiedlichen Konzepte bezüglich der Selbstdarstellung trugen ihr Übriges dazu bei, dass ich meinen GesprächspartnerInnen gegenüber als arrogant erscheinen musste. Es war mir aber zum Glück schnell klar, dass die Unterschiede bezüglich Kommunikationsregeln und den damit verbundenen soziokulturellen Konzepten tief greifender waren als ich anfänglich angenommen hatte. Noch wichtiger war die Erkenntnis, dass sich unbemerkt einige kulturell-kommunikative Elemente in meinen Kopf eingenistet hatten, die auf meinen Aufenthalt in Deutschland zurückzuführen waren. Damit wurde mir klar, dass meine Identität einem ständigen, offensichtlich nie zu Ende gehenden Umwandlungsprozess unterliegt, und dass ich meine Identität – jenseits der wissenschaftlichen Auseinandersetzung – nie würde erfassen können. Ich nehme an, dass in diesem Saal viele von Ihnen ähnliche Reisen durchgemacht haben oder eben durchmachen. Ob Sie nun von Zürich in die Romandie oder vom Tessin nach Bern dislozieren, gewisse Ähnlichkeiten mit meiner Geschichte können sicherlich konstatiert werden. Mit einem Tessiner/einer Tessinerin in Zürich habe ich eventuell mehr gemeinsam als Sie vielleicht ahnen können. (...)
Mit dieser Reflexion gehe ich zum zweiten Punkt über, nämlich der Bestandesaufnahme, die ich nun mit Hilfe dieser Skizze erläutern will. (...)
Sie macht deutlich, welche komplexen Fähigkeiten und Voraussetzungen beispielsweise DolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen unter Ihnen erbringen müssen, um Ihre äußerst anspruchsvolle Arbeit bewältigen zu können.
|
|
|
|
Folie 4: Kommunikationsebenen
Diese Abbildung zeigt die uns bisher bekannten Ebenen der Kommunikation im Allgemeinen. Die hier anatomisch gezogenen Trennlinien zwischen den Ebenen sind in Wirklichkeit nicht existent. Sie dienen lediglich dem besseren Verständnis.
Bitte notieren Sie in Stichworten, was Ihnen zu den jeweiligen Ebenen einfällt und diskutieren Sie dies kurz mit Ihrem Sitznachbarn/Ihrer Sitznachbarin! (...)
Ich werde nun einige dieser z.T. von Ihnen genannten Stichworte aufgreifen und mit Ihnen darüber diskutieren, was diese Elemente im interkulturellen Kontext anrichten können. Damit sind wir bei den Ursachen von Missverständnissen:
Die erste Ursache für Missverständnisse resultiert zunächst aus den kulturell bedingten Unterschieden von Bedeutungen ein und desselben Zeichens oder Signals. In der interkulturellen Kommunikation ist es grundsätzlich so, dass monokulturell überlieferte Deutungsmuster für jeweils beide Beteiligten unbewusst als einzig richtige vorausgesetzt werden. Jeder Gesprächspartner/jede Gesprächspartnerin verbarrikadiert sich hinter seinem/ihrem Erklärungsmuster und versucht – wiederum unbewusst – dem kommunikativen Verhalten des Gegenübers nach zu urteilen.
Schauen wir uns die verbale Ebene genauer an. Sie wissen aus der Praxis, dass für eine Fülle von Begriffen keine lexikalischen Entsprechungen in anderen Sprachen existieren. Eine Übertragung ist nur sinngemäß möglich. Darüber hinaus können genau dieselben Begriffe für die Beteiligten unterschiedliche Bedeutungen haben, weil ich mich auf Abstrakta, Konkreta, Institutionen, Funktionales oder Affektives beziehe, wenn ich Worte benutze.
Ich bitte Sie nun einige Beispiele für die letztgenannten Kategorien zu nennen (...)
Beispiele können also sein: Demokratie, Menschenrechte, Arbeit, Stuhl, Haus, Familie, Heiraten, Liebe, Abneigung, Zuneigung etc. Nehmen wir doch – um die Sache nicht noch komplexer zu machen – anstelle des Beispiels «Demokratie» das Beispiel «Liebe».
Jede Kommunikationskultur hat ihre prozesshafte Vorstellung über die Liebe und die damit verbundenen Liebesstufen bis zur sexuellen Bedürfnisbefriedigung. Eine japanische Kollegin, die mit einem Deutschschweizer verheiratet ist, erzählte mir neulich, dass genau diese mit genau definierten Inhalten versehenen Stufen des Liebesprozesses zu Missverständnissen in ihrer Beziehung geführt hatten. Während in Japan das Kennenlernen der zukünftigen Schwiegereltern erst unmittelbar vor der Heirat erfolgt und praktisch als Heiratsantrag gilt, ist dies für Schweizerinnen und Schweizer problemlos zu Beginn einer Beziehung möglich und wird normalerweise nicht als Heiratsantrag verstanden. Für die Japanerin war die Überraschung dementsprechend groß, als ihr Partner seinen Eltern in der Schweiz eine gemeinsame Weihnachtskarte aus Tokio schicken wollte, denn die Beziehung war noch ganz am Anfang. Sie verstand die Sache als Heiratsantrag und da sie ihren Partner liebte, willigte sie ein und unterschrieb die Karte. Was danach folgte, war eine Diskussion über die Folge des gegenseitigen Missverständnisses: Für die Japanerin war es selbstverständlich, dass sie nach der Bekanntmachung der Beziehung bald heiraten würden. Ihre Sicht der Dinge bestimmte ihr Verhalten in der Beziehung, während der Partner die Bedeutung der von seinem Standpunkt aus harmlosen Aktion überhaupt nicht realisierte und schon gar nicht als Verpflichtung zum Heiraten verstand. Für ihn war es selbstverständlich, dass er sich auf das Unternehmen Heirat erst einlassen wollte, wenn die Beziehung in der Praxis für eine gewisse Zeit auf dem Prüfstand gestanden hatte. Die Beziehung musste sich erst bewähren. Erst etliche Jahre nach der Heirat wurde ihnen die Ursache für ihr Missverständnis bewusst. (...)
Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus der nonverbalen Ebene präsentieren und mit Ihnen die Unterschiede diskutieren, nämlich den Blickkontakt. (...)
Die Ergebnisse Ihrer Diskussion zeigen, dass mit dem Blickkontakt eine sehr breite Palette von Bedeutungen ganz gegensätzlicher Natur verbunden ist. Unsere Gewohnheit, sich während des Gesprächs in die Augen zu schauen, verbinden viele von Ihnen mit bestimmten Eigenschaften. Je nach Intensität, überwiegen positive Attribute wie «Interesse zeigen», «Ehrlichkeit» etc. Die Vermeidung von Blickkontakt belegen dieselben Damen und Herren mit «Desinteresse», «etwas verheimlichen», «Respektlosigkeit» etc. Beide Zuschreibungen dienen ihnen in der Kommunikation als Interpretationsschemata, die unbewusst wirken und als selbstverständlich und grundsätzlich allgemein gültig angenommen werden. Im Saal habe ich allerdings diesbezüglich unterschiedliche Ansichten vernommen, die auch richtig sind. Sie resultieren aus der unterschiedlichen kulturellen Herkunft der Anwesenden. Es ist eine Tatsache, dass die Bedeutungen des Blickkontakts kulturell bedingt sind und daher sehr unterschiedlich ausfallen können. Was für Sie unbewusst als Ausdruck einer Respektlosigkeit identifiziert wird, ist für mich oder für eine andere Person in einem anderen kulturellen Kontext Ausdruck höchst respektvollen Verhaltens!
Diese scheinbar harmlose Bedeutung eines Kommunikationssignals, welche wir unbewusst lernen, hat in der Praxis gravierende Nebenwirkungen und zwar in allen Lebensbereichen.
Vor geraumer Zeit habe ich bei einigen Ärzten/Ärztinnen diesbezüglich eine kleine Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse waren alarmierend: Einige Ärzte würden einem Patienten/einer Patientin bei fehlendem Blickkontakt Simulation unterstellen, mit der Absicht möglicherweise ein Attest zu bekommen. Dies allein auf Grund der Deutung des Blickkontaktes!
In Zusammenhang mit Behörden habe ich früher selbst erlebt, dass ich unglaubwürdig erschien, allein wegen dieses mysteriösen Blickkontakts! Auch während meines Studiums, als ich in die Sprechstunden zu meinen Professoren ging, sagten manche von ihnen: «Kommen Sie rein und seien Sie nicht so schüchtern!» Dabei war ich gar nicht schüchtern. Sicher nicht gegenüber den männlichen Professoren - allenfalls vielleicht in der Begegnung mit der «zweiten Hälfte des Himmels»...
In meiner interkulturellen Klärungshilfe für bikulturelle Partner, mache ich zum Problemkreis «Blickkontakt» ständig erstaunliche Erfahrungen. In der internationalen Politik oder in internationalen Wirtschaftsbeziehungen sind die Folgen nicht minder gravierend. Ganz sicher kennen Sie Beispiele aus Ihren Lebensbereichen. (...)
Neben den kulturbedingten Divergenzen auf der verbalen und nonverbalen Ebene der Kommunikation kollidieren in der interkulturellen Kommunikation auch unterschiedliche Konventionen der paraverbalen Elemente miteinander. Dazu zählen Sprechtempo, Lautstärke, Prosodie oder Redepausen. Die Regeln, wie z.B. Pausen im Gespräch eingesetzt werden, führen oft zu Irritationen, wenn nicht sogar zu Frustrationen.
Jede Kommunikationskultur hat ihre eigenen Regeln, die unbewusst befolgt werden. Beispielsweise legen manche Personen als Gesprächsbeendigungssignal tendenziell kaum erkennbare Pausen ein, andere kurze Pausen, die einen Bruchteil einer Sekunde bis ca. 2 Sekunden betragen. Die Chinesinnen und Chinesen oder die Japanerinnen und Japaner kennen Pausen je nach Situation, die bis zu 20 Sekunden dauern.
Um niemandem zu nahe zu treten, will ich von mir ausgehen: Wenn ich mich vergesse, wie Sie dies möglicherweise gerade beobachten, rede ich ziemlich schnell, fast wie ein Wasserfall. Als ich in die Schweiz kam, war das noch viel schlimmer, sodass meine Lebenspartnerin mit mir den «Schweizerstil» trainierte. In der Interaktion mit Deuschtschweizern hatte ich Mühe damit, die eingelegten Redepausen richtig zu deuten, vor allem dann, wenn sie mit dem häufig auftretenden «oder» in Verbindung standen. Anfänglich habe ich darauf reagiert, indem ich die Sprechhandlung meines Gegenübers bestätigte, verneinte oder sonstwie kommentierte. Sie können sich vorstellen, wie sich meine Deutschschweizer Gesprächspartner dabei fühlten. Und umso schwieriger die Verständigung war, wenn mein ursprünglicher arabischer Stil zur Anwendung kam. Dann waren die als Gesprächsbeendigungszeichen eingelegten Pausen selbst für sehr geübte Augen und Ohren nicht mehr erkennbar. (...)
In Verhandlungen zwischen Deutschen und Deutschschweizern legen die Deutschschweizer relativ lange Gesprächspausen ein, was von den Deutschen als Gesprächsbeendigungssignal wahrgenommen und interpretiert wird. Daraufhin beginnt der/die Deutsche zu sprechen. Die Schweizer Gesprächspartnerin/der Schweizer Gesparächspartner sieht sich dadurch unterbrochen. Die Schlossfolgerung seitens der Deutschschweizer könnte lauten: «Die lassen einen nicht ausreden.» oder «Die fallen einem ins Wort.»
Südlich der Alpen begegnen wir wiederum ganz anderen Regeln. Wenn Sie sich eine Talk-Show oder eine Diskussionsrunde eines italienischen Senders ansehen, dann bemerken Sie deutliche Unterschiede zum eigenen Stil. Die Hände bewegen sich ständig, es wird laut und schnell gesprochen und nicht zuletzt wird fortlaufend unterbrochen. Ein heilloses Durcheinander! Was wir aber nicht wissen, ist, dass in diesem - beispielsweise für Deutschweizer oder Chinesen - scheinbaren Chaos höchst komplexe Ordnungen und Strukturen bestehen, die sich nur so stark von den unseren unterscheiden, dass sie uns verborgen und damit und unverständlich oder unbewusst bleiben. Vielleicht haben Sie sich beim Betrachten aber auch zu Hause gefühlt... (...)
Um die Wirkung solcher Unterschiede auf den Verlauf einer Verhandlung abzuschätzen, lade ich Sie ein, mit mir eine kurze Übung zu machen, ähnlich wie wir dies in unseren Verhandlungstrainings für Führungskräfte tun. Wir stellen in einer Gesprächssituation die Art und Weise wie wir hier im Saal Redepausen einsetzen derjenigen in China gegenüber. (...)
Aus der Diskussion möchte ich folgendes festhalten: Sie haben selbst festgestellt, wie schwierig es ist, längere Pausen aushalten zu können als Sie sich gewohnt sind. Die meisten empfanden lange Redepausen als unangenehm, wurden nervös oder unruhig. Möglicherweise kamen Gefühle des Unbehagens hoch, weil die Toleranzgrenze der Pausenlänge überschritten wurde. Es ist sicherlich nicht einfach, still bleiben und abwarten zu können. Je länger die eingelegte Pause des Gegenübers ausfällt, desto stärker wird das Gefühl etwas sagen zu müssen, um die unangenehme Pause zu überbrücken. Ergreifen Sie dann wieder das Wort, so fühlt sich z.B. Ihr chinesischer Gesprächspartner gedrängt. Denn wenn Sie dies z.B. in der Funktion als Mitglied einer Wirtschaftsdelegation tun, kann es sein, dass Sie Ihr Angebot dadurch zu Ihren eigenen Ungunsten beeinflussen, weil Sie dem chinesischen Gesprächspartner nicht genügend Zeit eingeräumt und das Schweigen als Unzufriedenheit mit dem Angebot gedeutet haben. Wie auch immer: Tiefgreifende Kenntnisse kulturspezifischer Divergenzen sind eine wichtige Vorraussetzung für eine erfolgreiche Kommunikation in internationalen Wirtschaftskooperationen und politschen Beziehungen.
In den Bereichen Bildung, Sozial- und Gesundheitswesen sind die materiellen Folgekosten, ausgelöst durch die Unkenntnis unterschiedlicher Konventionen wie Redepausen, unbezifferbar. Die menschliche Komponente wiegt jedoch weit schwerer. Ein Beispiel dazu aus dem Bildungsbereich: Einem Kind wurde durch Schulpsychologen und Lehrkräfte ein gestörtes, auffälliges Verhalten attestiert, worauf das Kind in eine Sonderklasse versetzt wurde. Einziger Grund: Das Kind unterbrach ständig und fiel den anderen ins Wort! Dieses Beispiel ist leider keine Ausnahme. Sehr viele Migranten-Kinder können davon betroffen sein. (...)
Kulturspezifischen Strukturmerkmale begegnen uns auch auf der extraverbalen Ebenen der Kommunikation. Dazu gehört u.a. das Raumerleben. Hier sind zwei miteinander verknüpfte Aspekte zu beachten, die von einer Kommunikationskultur zur andern sehr stark variieren: Die Raumvorstellung und das Verhalten im Raum. Letzteres hat u.a. mit der räumlichen Distanz zum Gesprächspartner/zur Gesprächspartenrin zu tun. Aus zeitlichen Gründen beschränken wir uns darauf. Während ich vorher mit dem Gentleman hier vorne sprach und ihm dabei näher kam, als er sich gewohnt ist, versuchte er unbewusst die Distanz zu mir zu korrigieren, indem er etwas weiter nach hinten rückte. Ich meinerseits bewertete, vorerst ebenfalls unbewusst, dass diese Distanz für mein Empfinden unhöflich sei. Ich bewegte mich in seiner Richtung, um ihm wieder näher zu kommen - soweit, wie ich dies für richtig und angemessen hielt. Er aber tat seinerseits wieder das Gleiche und hielt die Distanz, die er als angenehm und respektvoll empfindet. Sie merken: Das Ergebnis ist ein ständiges unbewusstes Korrigieren und Gegenkorrigieren des vermeintlichen Fehlverhaltens des Gegenübers. Die Situation würde noch um einiges komplexer, wenn mein Gesprächspartner eine Frau wäre. Das harmloseste Prädikat, welches ich auf Grund meines Verhaltens in Bezug auf die räumliche Distanz erhalten würde, wäre: aufdringlich!
Verlassen wir nun die Divergenzen und Kulturgebundenheit der Kommunikationsebenen und widmen unsere Aufmerksamkeit der dritten Ursache von Missverständnissen in der zwischenmenschlichen Kommunikation im interkulturellen Kontext.
Es handelt sich um das Zusammenspiel von verbalen und anderen Ebenen der Kommunikation.
Die kulturbedingte, spezifische Art und Weise der gesprochenen Worte im Zusammenspiel mit anderen Signalen wie Mimik, Blickkontakt, Körperhaltung, Raumverhalten etc. muss richtig gedeutet werden, damit das Gemeinte wirklich verstanden wird.
Ist das, was ich eben vernommen habe eine Beschwichtigung, eine Bekräftigung oder sogar eine Verneinung des gesprochenen Wortes? Ist es ironisch gemeint oder todernst? Stellen Sie sich z.B. eine Flirtsituation vor. Entscheidend über Erfolg und Misserfolg in der Kommunikation ist das Zusammenspiel aller Komponenten, so wie Sie dies von ihrem monokulturellen Hintergrund her kennen. Im interkulturellen Kontext liegt der Schwierigkeitsgrad wesentlich höher. Wie wir gesehen haben verfügen wir dort nicht über die gleichen Interpretations- und Deutungsgrundlagen. (...)
Darüber hinaus verkörpert und vermittelt das Zusammenspiel als Ganzes in der Kommunikation tiefer liegende Inhalte. Damit sind wir bei der vierten möglichen Ursache von Missverständnissen. Die Rede ist von soziokulturellen Konzepten, die historisch gewachsen und nur in ihren soziokulturellen Zusammenhängen begreifbar und deutbar sind. Diese umfassen auch die Art und Weise wie wir denken, argumentieren und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten. Es ist z.B. kulturell gebunden, in welchem Verhältnis der persönliche, private und der sachliche Bereich zu einander stehen. Auch der Umgang mit Konflikten und Kritik ist kulturell gebunden. Die Liste von soziokulturellen Konzepten liesse sich beliebig erweitern. Z.B. Welchen zeitlichen Bezugsrahmen setzen wir für unser Handeln und Erleben? Welche Rolle spielt die Vergangenheit für unsere Zukunft? In welchem Ausmass bestimmt dies die Gewichtung bei der Planung von Gesellschafts- und Lebensentwürfen? (...)
Um meine bisherigen Ausführungen – das Gesagte und Gemeinte – abzurunden, habe ich für Sie einen Videofilm mitgebracht, dessen Handlungssituation aus dem Sozialwesen stammt. Es handelt sich um eine interkulturelle Begegnung, die in allen Lebensbereichen vorkommen kann. Wir schauen uns daraus eine 3-minütige Sequenz an und versuchen anschliessend darüber zu diskutieren. (...)
Von den diskutierten Aspekten will ich die folgenden hervorheben: Die Fachkraft im Film zielt in der Art ihrer Befragung auf lineare Ja-/Nein-Antworten ab, um dann sofort zur nächsten Frage überzugehen. Währenddessen bleibt sich der Klient (Migrant) seiner zirkulären, kontextabhängigen Darstellung treu. Er beginnt zunächst mit der allgemeinen Schilderung seiner Situation und nennt Einzelinformationen und Aspekte, die ihm für die Situationsklärung wichtig zu sein scheinen. Auf diese Aspekte wollte die Befragerin aber in diesem Moment nicht eingehen. Deswegen war sie zunehmend ungeduldig und offensichtlich verärgert unterbrach ihn dauernd und will nun nur wissen: Waren Sie dort? Ja oder Nein! Sie erwartete konkrete und explizite Antworten auf ihre Fragen. Nach ihren Regeln der Kommunikation hat der Migrant «um den heissen Brei herum geredet». In ihren Augen will er etwas vertuschen. Der Klient seinerseits ist verärgert und versteht ihr Insistieren nicht . Aus seiner Sicht sind die Fragen zusammenhangslos. Für ihn ist der Kontext entscheidend, damit er die entsprechende Antwort einordnen und verstehen kann. Für ihn ist die Ursache des Übels bald ausgemacht: Die Frau interessiert sich in Wirklichkeit nicht für seine Situation und ist für ihn daher vertrauensunwürdig. Im übrigens erlebe ich diese Unterschiede oft auch im privaten Situationen (...)
Der Film hat im weiteren ganz eindrücklich die Korrespondenz der verbalen Äusserungen mit den anderen Elementen der Kommunikationsebenen aufgezeigt.
Wie so oft bei der Interkulturellen Kommunikation im Migrationskontext sind auch hier weitere Problemfelder zu berücksichtigen, die die Kommunikation a priori sehr störanfällig machen: Zum einen wurde die allgemein und überall in der Welt anzutreffende asymmetrische und abwertende Kommunikationsart der Einheimischen mit den Migranten und Migrantinnen sichtbar. Man/frau kann leider auch in diesem Fall vom klassischen Schuh-Putzer-Modell sprechen. Zum anderen können entwickelte Handlungsstrategien im Umgang mit Migration seitens der Migranten und Migrantinnen selbst einen zweiten Baustein der Verständigungsbarrieren bilden. Beide Faktoren beeinflussen leider den Verständigungsprozess in seiner Anfangsphase sehr stark. (...)
Meine Damen und Herren, auch die zeitliche Verlängerung unserer Diskussion nähert sich leider dem Ende. Es sei daran erinnert, dass sich ungewollte Missverständnisse erst dann bewältigen lassen, wenn wir Menschen symmetrisch, also auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und nicht dem national wie international vorherrschenden Schuh-Putzer-Modell zum Opfer fallen. (...)
Vielleicht konstatieren Sie mit mir, dass alle genannten Aspekte der «Interkulturellen Kommunikation» in sämtlichen interkulturellen Überschneidungssituationen, ob in der Politik, Wirtschaft oder im Sozialen zur Geltung kommen. Erfreulicherweise ist es sowohl Ihrem Interesse wie Ihren fachlichen Interventionen als auch der allgemeinen Beobachtung zu entnehmen, dass dem Faktor «Interkulturelle Kommunikationskompetenz» eine zunehmende Bedeutung beigemessen wird. Nicht nur in internationalen Tätigkeitsfeldern sondern auch in allen Gesellschaftsbereichen ist dieser Faktor unumgänglich geworden.
Ich fasse aus meiner Sicht die Lösungsansätze in zwei Punkten zusammen:
Real existierende Utopie: Interkulturelle Kommunikationskompetenz wird gesamtgesellschaftlich aus realen Gegebenheiten zur bildungspolitischen Frage. Diese Notwendigkeit lässt sich aus mindestens vier Faktoren erklären: Als wesentlich und entscheidend beurteile ich die genuine kulturelle Vielfältigkeit der Schweizergesellschaft. Zusätzlich wird diese kulturelle Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit der Schweiz durch die zunehmenden bikulturellen Partnerschaften und ihre Sprösslinge um eine Dimension erweitert. Zum dritten stellen die Migranten und Migrantinnen und ihre bikulturellen Nachkommen einen zentralen Bestandteil gesellschaftlicher Realität dar. Hinzu kommt eine beträchtliche Zahl an AuslandschweizerInnen. Wenn es gelingen würde, diese menschlichen, brachliegenden Ressourcen zu aktivieren, liessen sich gesamtgesellschaftlich gesehen ungeahnte strategische Handlungsmöglichkeiten entfalten. Das wäre allerdings eine bewusste strategische Entscheidung für die Schweiz. Angesichts der aktuellen politischen Agitation ist dies aber noch utopisch.
Gegenwartsbezogene Realisierungsmöglichkeiten: Interkulturelle Kommunikationskompetenz wird zum festen Bestandteil der Weiterbildungsprogramme für die MitarbeiterInnen der staatlichen, halbstaatlichen und privaten Institutionen. In der Privatwirtschaft ist das Interesse diesbezüglich in den letzten Jahren deutlich gewachsen, währenddem die Situation im Sozial-, Bildungs-, und Gesundheitswesen zu wünschen übrig lässt. Aber vielleicht ändert sich dies im Zuge der Diskussion über die Integration, was auch immer darunter verstanden und damit bezweckt wird.
Meine Damen und Herren
Hoffentlich konnten Sie aus den Ausführungen und den Diskussionsbeiträgen den einen oder anderen Gedanken mitnehmen. Für mich war die Begegnung mit Ihnen höchst interessant und bereichernd. Entsprechend habe ich einiges dazu gelernt.
Herzlichen Dank für die aktive Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit, insbesondere, dass Sie Ihre Kaffeepause für die freiwillige Fortsetzung der Diskussion geopfert haben.
Ich wünsche Ihnen weiterhin kreatives interkulturelles Schaffen und hoffe, Ihnen in anderen Zusammenhängen wieder zu begegnen.
* Modifizierte Abschrift des Vortrags vom 15.11.04, gehalten am Sprachentag der Bundeskanzlei, Bern
I zurück zu «Fachartikel/Vorträge/Interviews
|
|